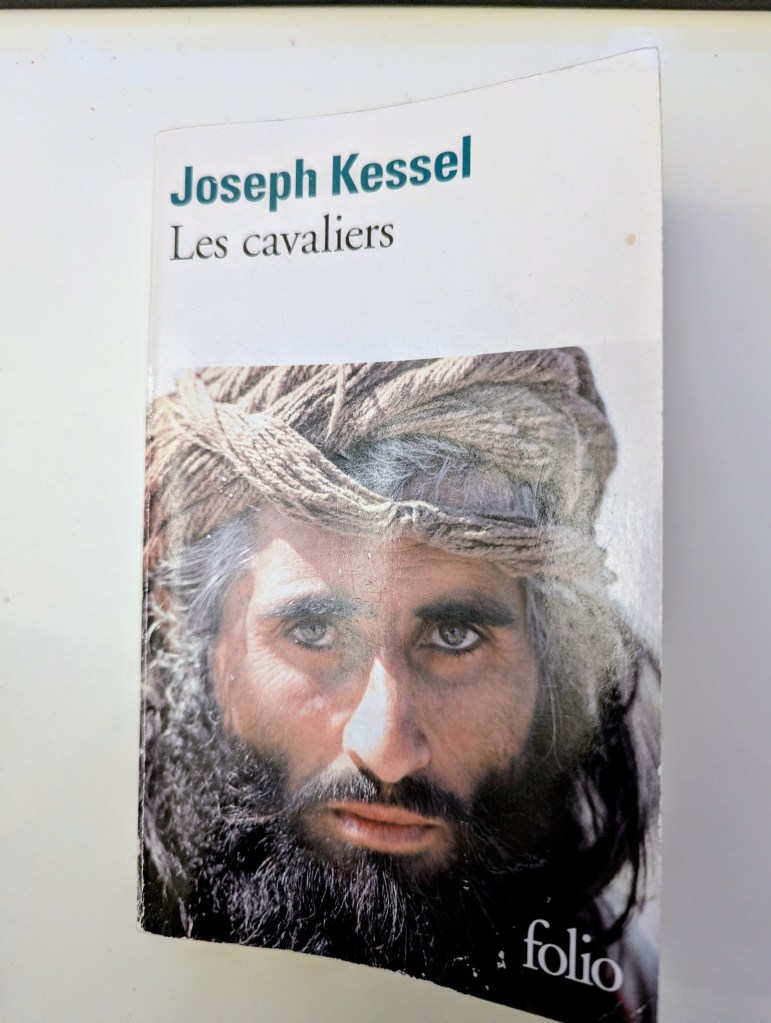Man kann nicht zufällig an diesen Ort kommen. Wer ihn betreten will, muss dieses Ziel mit vollem Vorsatz ansteuern, da es nur zwei Zugänge gibt: einen über einen kleinen Pfad von Eschersheim kommend, lange nach den letzten Mehrfamilienhäusern. Und einen weiteren über eine Landstraße, die durch die Felder führt.
Er liegt versteckt in einem kleinen Wald, eingezwängt von der Autobahn. Kaum dass man beim Vorbeifahren aus dem Augenwinkel das schräge Dach des einzigen festen Gebäudes und die Dächer der Wohnwagen sieht, die sich eng aneinanderducken.
Am Rand der Stadt befindet sich ein eigenartiger, aus der Zeit gefallener Ort, von dem die koks- und ritalingedopten Anzugträger, die sie bevölkern, noch nie etwas gehört haben.
Und das war von der Stadt Frankfurt, als sie diesen Ort dort anlegte, auch genau so gewollt.
Der Bonameser Wohnwagenstandplatz oder – um die 70er-Jahre Diktion zu benutzen: die Bonameser Wohngemeinschaft – beherbergt ein kurioses, widerborstiges Völkchen, das in gerader Linie seit mehreren Generationen dort wohnt, teils auch miteinander verwandt ist und Außenstehenden, die sie in ihrem Schaustellerjargon „Private“ nennen, gegenüber sehr misstrauisch ist.
Ich habe es trotzdem geschafft, mit einigen Bewohnern Gespräche zu führen. Manche haben abgelehnt, aber das ist manchmal so. Das muss man respektieren.
Derzeit leben dort etwa zu gleichen Teilen Schausteller, die teils von illustren deutschen Artistenfamilien abstammen, sowie Menschen mit ganz normalen Bürojobs.
In seinen Ursprüngen war das nicht immer so.
Ein Provisorium von 70 Jahren
Wie alle deutschen Städte lag auch Frankfurt nach den Flächenbombardements des Zweiten Weltkriegs am Boden, große Teile der Innenstadt waren zerstört, der Wohnraum knapp.
Durch die Städte irrten Verstörte und Versprengte mit Koffern, Rucksäcken und Handwagen. Familien bezogen notdürftig hergerichtete Ruinen, Wellblechhütten oder die nunmehr nutzlosen Hochbunker. Einige von ihnen lebten in Wohnwagen auf Trümmergrundstücken.
(Nur ein kleiner Exkurs: diese Zeit unmittelbar nach dem Krieg bis zum Beginn des Wirtschaftswunders ist normalerweise ein blinder Fleck in der Geschichtsschreibung, über die wenig bekannt ist. Ich empfehle Keith Lowes Buch „Der wilde Kontinent. Europa in den Jahren der Anarchie 1943 – 1950“ bei Klett-Cotta).
Zu Beginn der 1950er Jahre beschloss der Magistrat der Stadt Frankfurt, dass die Nachkriegszeit beendet sei und die Ausprägungen des Chaos ab sofort aus dem Stadtbild zu verschwinden hätten. Die Wirtschaftswunderjahre waren da und alle Gescheiterten und Gestrauchelten, die den Anschluss nicht geschafft hatten, sollten die neue Idylle nicht stören. Auch sollten Menschen, die nicht nach dem spießigen, bürgerlichen Lebensideal leben wollten oder konnten aus dem Stadtbild verschwinden. Vor allem sollten die Trümmergrundstücke für eine Neubebauung freigemacht werden.
In Deutschland hatte schon längst die Verdrängung der Vergangenheit begonnen, die Verbrechen wurden in das kollektive Unterbewusstsein verschoben, das Wirtschaftswunder hatte begonnen. Der Zeitgeist war auf das Nach-vorne-Schauen gerichtet. Die Spuren des verbrecherischen Krieges und all das intime Leid wurden aus der Öffentlichkeit verbannt. Wer das Tempo nicht halten konnte, wurde aussortiert und buchstäblich an den Rand gedrängt.
Ein kleines Stück Gelände an der Grenze zwischen Eschersheim und Bonames wurde von Landwirten enteignet, das Feldgelände mit Trümmerschutt befestigt, eingezäunt, die über das Stadtgebiet verteilte wohnungslose Bevölkerung eingesammelt, hinverfrachtet und sich selbst überlassen.
Dies war der Wohnwagenstandplatz Bonameser Straße (auch wenn er strenggenommen in Eschersheim liegt), später – in der Diktion der 1970er Jahre – auch Wohngemeinschaft Bonameser Straße genannt.
Eine bunt zusammengewürfelte Mischung unterschiedlichster Menschen bildete nun gezwungenermaßen eine kuriose Schicksalsgemeinschaft auf dem eingezäunten Areal: Ausgebombte und Schausteller, Landfahrer und Gelegenheitsarbeiter, Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten, Zirkusartisten, verarmte Rentner und Kriegsinvaliden, Obdachlose, Flüchtlinge aus der Ostzone, Zuhälter und Prostituierte, aber auch ehemalige KZ-Häftlinge. Manche der Bewohner gingen einer „geregelten Arbeit“ nach, hatten jedoch aufgrund der Wohnungsnot noch keine Wohnung bekommen.
Das Areal, das in seinen Anfängen nur ein unbefestigter Platz war, und auf dem zu seinen Hochzeiten Ende der 1950er Jahre 850 Menschen lebten, darunter 140 Kinder unter 14 Jahren, verfügte über keinerlei Versorgungseinrichtung und sonstige Anbindung an Wasser, Strom und Abwasser. Der Wasserzugang bestand aus zwei Hydranten als Wasserzapfstellen, ansonsten gab es keinen Strom, kein Licht, keinen Kanalanschluss, keine sanitären Einrichtungen. Die Menschen behalfen sich mit Kerzen und Petroleum-Lampen und zapften Strom von den Laternen und Verteilerkästen auf der Straße ab.
Im Jahr 1956 listete die Wohlfahrtsdeputation die Behausungen auf. Es waren dies „112 Wohnungen, 61 mit, 51 ohne Räder, 14 Omnibusse ohne Räder, Bretter- und Wellblechbaracken, 1 Möbelwagen“. Ferner gab es im hinteren Teil einen Schrottplatz, auf welchem Autos zerlegt und repariert oder die Einzelteile verkauft wurden.
Tadelnd wurde vermerkt, dass die Paare „zumeist in wilder Ehe“ lebten.
Auf eine Bürgereingabe erläuterte der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Leiske 1956 den Grund für das Anlegen des Platzes: „Dieser Platz wurde bewusst in einfacher Form hergerichtet, um den Umherziehenden keinen Anreiz zu geben, sich in Frankfurt sesshaft zu machen. Dies trägt dem Drang der Bewohner nach Freiheit und Gesetzlosigkeit Rechnung sowie den Zwang und Ordnung verabscheuenden Lebensgewohnheiten eines großen Teils der Platzbewohner. Zum anderen kann die Lebensweise dieser Menschen nicht mit normalen zivilisierten Maßstäben gemessen werden.“
Nicht nur im Einzäunen des Areals, auch in der verräterischen Sprache, der „Lingua Tertii Imperii“, mit der die „ordentlichen Bürger“ die Bewohner charakterisierten, zeigen sich die Denkmuster der untergegangenen Diktatur.
Die Bewohner der des Platzes wurden zu Beginn ganz ungeniert als „Insassen“ eines „Lagers“ bezeichnet, so wie KZ-Insassen oder Patienten von Irrenanstalten, wenn sie nicht gleich unter Sammelbezeichnungen wie „Zigeuner“, „Dirnen“, „Asoziale“ abqualifiziert wurden.
Bei der Lektüre der Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit, die ich in dem übrigens hervorragend geführten Archiv des Instituts für Stadtgeschichte gelesen habe, ist es mit dem Blick von heute schon sehr auffällig wie leichtfertig auch in offiziellen Briefen, das Wort „asozial“ verwendet wird.
Aber auch unter den Bewohnern lief es nicht immer konfliktfrei ab. Für die Abkömmlinge teils altehrwürdiger Artistenfamilien, die ein aristokratisches Selbstverständnis pflegten, war es unter ihrer Würde, mit „Gesindel“ auf dem Platz zusammengesteckt zu werden.
Auch heute ist es so, dass sich eine Familie, die Familie L., von allen anderen abseits hält. Warum das so ist, konnte mir keiner erklären.
Hinzu kam der Widerstand der Bevölkerung aus den umliegenden Wohngebieten. Die Bewohner waren Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt. Das galt insbesondere für die Kinder, die auf dem Platz lebten, die in der Schule von Schülern und Lehrern ausgegrenzt und benachteiligt wurden. Dies ist ein Thema, das bei den Gesprächen, die ich geführt habe, immer wieder aufkam, und offensichtlich bei den heute erwachsenen Bewohnern für nachhaltige Kränkungen und Verletzungen gesorgt hat.
Die schizophrene Stadt
Von Beginn an und bis zum heutigen Tag pflegt die Stadt Frankfurt ein schizophrenes Verhältnis zu dem Bonameser Wohnwagenplatz, auf dem heute noch ungefähr zwischen 50 und 70 Personen leben.
Es scheint so, als hätte die Stadt kurz nach dem Anlegen des Platzes ihre Entscheidung bereut.
Einerseits folgte die Stadt atavistischen Mustern der Konfliktbewältigung aus jüngster Vergangenheit durch „Ghettoisierung“ unerwünschter Bevölkerungsschichten, andererseits störte sie auch der „Schandfleck“, den sie nicht mehr auf dem Stadtgebiet haben wollte.
Schon nach wenigen Jahren begannen Bestrebungen, die Wohnwagenkolonie wieder aufzulösen.
Doch auch die Bewohner hatten einen Sinneswandel durchgemacht. Wollten die Menschen am Anfang nicht auf den Wohnwagenplatz ziehen, weil es einige von ihnen an Konzentrationslager wie Dachau und Buchenwald erinnerte, wollten sie nun nicht mehr weg. Sie hatten sich mit ihrer Situation abgefunden und verteidigten sie trotzig. Die starke Gemeinschaft der Bewohner, die sich auf dem Platz gebildet hatte, tat ihr Übriges.
Nach den harten Jahren des Beginns stellte sich im Wirtschaftswunderland auch auf dem Wohnwagenplatz ein relativer Wohlstand ein.
Die FAZ hat mehrere längere sehr interessante Artikel dem Bonameser Wohnwagenstandplatz gewidmet, die das Lokalkolorit aufnehmen und über eine bloße Faktenwiedergabe hinausgehen, so zum Beispiel die FAZ vom 26.09.1961:
„Wohnwagen-Standplatz – diesen Namen erfand die Behörde. Sie umschreibt damit, was nun sei acht Jahren auf hundertfünfzig Quadratmetern Eschersheimer Ackerland dahinvegetiert: eine Welt aus Latten, Tuchfetzen und Blech; mit Menschen, die sich die Zwangsjacke bürgerlicher Ordnung ausgezogen haben, um von der Hand in den Mund, jedoch nicht unbedingt schlecht zu leben. Auch im Lager der Armut existiert Wohlstand. Kühlschrank und Waschmaschine, die Fernsehantenne auf dem Wellblechdach und der komfortable Autoanhänger sind seine Zeichen.“
Auf dem zuvor unerschlossenen Gelände gab es nun einen Toilettenpavillon, Duschen, eine Spielstube und Waschmaschinen.
Das Fürsorgeamt versuchte, Wohnungen für die Menschen bereitzustellen, doch auch hier geschah dies auf die übliche paternalistische Weise, indem es sich „bemühte diejenigen Bewohner in feste Häuser umzuquartieren, die durch ihr soziales Verhalten eine Garantie dafür bieten, wieder in ein geordnetes bürgerliches Leben zurückfinden zu können.“
Einige nahmen das Angebot an, doch die große Mehrheit blieb auf dem Platz.
Manche, die umgesiedelt wurden, kamen auch zurück, weil sie sich in der Anonymität der Wohnblocks nicht wohlgefühlt haben oder auch von den Mietern in den Wohnsiedlungen als „Zigeuner“ diskriminiert wurden. Sie fühlten sich in einem Haus eingesperrt und vermissten die starke Gemeinschaft und den Zusammenhalt auf dem Platz.
Manche, die als Vertriebene und Flüchtlinge kamen, fanden nicht mehr den Anschluss an ein geordnetes, bürgerliches Leben und geregelte Arbeit.
In den 1970er Jahren leben noch viele Familien nach dem Rhythmus des Zirkus und kamen zwischen den Tourneen auf den Platz zurück, so dass die Bevölkerungsanzahl teilweise stark schwankte. Manche Familien arbeiteten in der Saison als Schausteller (Schaugewerbe), und außerhalb der Saison als Korbflechter, Scherenschleifer, Schrotthändler.
Die Zukunft des Platzes
Den Platz hat die Stadt bis heute indes nicht auflösen können.
Nach Wegzug oder Ableben der Bewohner werden die zurückgebliebenen Wohnwagen zerstört und die Neuansiedlung verboten.
Dies ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer die Methode der Stadt, den Platz aufzulösen. Die ungenutzten Parzellen werden durch massive Metallbügel abgesperrt, so dass keine neuen Wohnwagen mehr darauf abgestellt werden können. Denn die listigen Bewohner sind Meister darin, sich schnell noch einen Platz zu sichern, um einen Wohnwagen oder Fahrgeschäfte darauf zu parken.
So soll sich das „Problem“ mit der Zeit biologisch lösen.
Auf diese Weise existiert dieses anachronistische Relikt aus der Nachkriegszeit noch immer als ein irgendwie nie vollständig legalisiertes Dauerprovisorium.
Auf dem unübersichtlichen Areal stehen noch 24 bewohnte Wagen. Auf vielen Parzellen wurden die Wagen auch durch kleine bungalowartige Häuser ersetzt. Alle Behausungen haben Wasseranschluss und sanitäre Anlagen.
Es ist eine verschworene Gemeinschaft, die nach tradierten Gesetzen und Regeln lebt, die in unserer heutigen modernen, beliebigen Gesellschaft wie aus der Zeit gefallen scheinen.
Es gibt eine starke Solidarität, kranke und alte Familienmitglieder werden von der Familie und der Gemeinschaft gepflegt. Kein Bewohner wird in ein Altersheim abgeschoben, sondern bleibt bis zum Schluss auf dem Platz.
Alle Familien sind auch über mehrere Ecken miteinander verwandt und verschwägert.
Gespräche
Man kommt nicht unbemerkt hinein in die Wohngemeinschaft Bonameser Straße.
Tagsüber könnte man glauben, die kleine Wohnwagensiedlung sei verlassen. Doch die Instinkte des Besuchers spüren die forschenden, wachsamen Augen. Hinter den Fenstern bewegen sich Gardinen. Niemand kommt heraus.
Personen, die mit den Menschen dort vertraut sind, warnten mich. Ich könne da nicht einfach hineinlaufen und auf die Leute zugehen. Das würden sie nicht zulassen.
Ich habe es natürlich trotzdem versucht. Aber ich musste einsehen, dass es so nicht funktionierte.
Wie in Konfliktgebieten benötigt man einen Fixer, der einen in die Gemeinschaft der Wohnwagenbewohner einführt. Dies war bei mir Frau Sonja K. von der Evangelischen Kirche, die mit mir zunächst ein Gespräch führen wollte, um zu erforschen, was ich vorhatte. Sie stellte mich dann vor und nachdem ich mein Anliegen geschildert hatte, fassten die Menschen ein vorsichtiges Vertrauen zu mir, auch wenn einige keine weiteren Auskünfte über ihre Biographie geben wollten.
Ich habe längere Zeit an diesem Artikel gearbeitet, ihn wieder beiseitegelegt, ihn mir wieder vorgenommen und wieder weggelegt. Wie das so ist, weil ich in der Zeit keinen Zugang zu dem Artikel finden konnte, nicht wusste, welche Form ich ihm geben sollte oder weil mich zwischendrin etwas anderes mehr interessierte. Vor allem wollte ich gerade nicht, wie die Reporter zuvor auftreten, wegen derer die Bewohner so abweisend sind: Tölpel, die auftauchen, in die Privat- und Intimsphäre der Bewohner eindringen, ihnen ihre Geschichten entreißen und dann wieder sang- und klanglos verschwinden. Das ist eine Gratwanderung, bei der ich selbstkritisch nicht so recht wusste, ob ich auch zu diesem Menschenschlag gehöre.
Die Gespräche haben im Jahr 2018 stattgefunden.
Im Juli 2018 spreche ich mit Karl K.
Er schildert mir gleich zu Beginn die typischerweise anfallenden Ärgernisse. Er hatte nämlich eine Parzelle gemietet, um seine Schiffschaukel darauf abzustellen. Dann hatte er darauf einen Carport gebaut. Die Wohnheim GmbH, die das Gelände für die Stadt verwaltet, will den Rückbau. Jetzt ist er in einen müßigen Rechtsstreit verwickelt.
Der blonde und blauäugige Mann lädt mich in sein Haus ein, dass aus mehreren zusammengefügten Bürocontainern besteht. Davor ist eine kleine Veranda, auf der Kühlschränke stehen. Er schenkt mir eiskaltes Wasser daraus ein.
Er führt mich drinnen herum. Alles ist pieksauber und aufgeräumt.
Er erzählt mir, dass seine Mutter Hochseilartistin gewesen war und aus Kassel stammte. Nach einem Unfall, bei dem sie vom Seil abstürzte, arbeitete sie im Schaustellergewerbe.
Sie betrieb eine kleine Ponybahn. Der Vater war Korbflechter und Kesselflicker.
Herr K. ist auf dem Platz aufgewachsen und lebte später in Niederrad. Er arbeitete dann teilweise im Schrottgewerbe und im Containerdienst. Mit seiner Frau lebte er zwanzig Jahre lang in einer Wohnung in Frankfurt-Preungesheim. Nach der Trennung kam er wieder zurück auf den Platz.
Die Anziehungskraft des Platzes und seiner Bewohner war zu groß, um ihr zu entkommen.
August 2018.
Ich bin bei Frau H. und Herrn S. zum Kuchenessen verabredet. Sie serviert ein hervorragendes Blech mit selbstgebackenem Kuchen (Heidelbeeren, Himbeeren, Aprikosen, Erdbeeren).
Frau H. hat nämlich eine Ausbildung zur Konditorin gemacht, musste aber wegen einer Mehlallergie abbrechen. Jetzt arbeitet sie in der IT für eine große deutsche Bank in der Innenstadt. Sie vermeidet es aber gegenüber Kollegen, wie viele der Bewohner, die „Bürojobs“ haben, ihren Wohnort zu nennen.
Auch hier ist das Haus peinlich sauber und aufgeräumt. Es liegt nichts herum.
Mit dabei ist ihr Lebensgefährte Klaus S. Er ist auf dem Platz aufgewachsen.
Frau H. allerdings ist „Private“, d.h. zugezogen. Sie ist gebürtige Wiesbadenerin, ihre Mutter stammt aus Kaufungen und kam nach dem Krieg nach Frankfurt.
Die Eltern von Herrn S. stammen aus Schlitz bei Fulda. Sie waren Schausteller. Er ist gemeinsam mit seinem Bruder im Recyclinggewerbe tätig.
Frau H. wuchs als Kind ganz in der Nähe auf und kannte den Platz und die Kinder vom Spielen.
Sie stammt aus einer gewaltgeprägten Familie. Die Mutter war psychisch krank, hat sie geprügelt, sie ist dann mit 15 zu ihrem Freund und heutigen Lebensgefährten Herrn S. geflohen. Mittlerweile ist sie seit 32 Jahren auf dem Platz gemeldet.
Sie berichtet, dass die vielen Krebserkrankungen auf dem Platz auffällig seien. Vielleicht Nachwirkungen des verseuchten, schadstoffbelasteten Schrottplatzes, der mittlerweile aufgelöst wurde?
Beide sind auf dem Platz fest verwurzelt und haben nicht vor, ihn freiwillig zu verlassen.
Dieser Platz ist ein kleines Steinchen im immer kleiner werdenden Mosaik, das sich der von Uniformität geprägten Stadt entzieht. Jeden Tag habe ich zunehmend das Gefühl, als würden die Normopathen mit ihren Insignien der Zugehörigkeit zur Kaste der Erfolgreichen, ihren Businesskostümen, ihren kleinen Laptoptäschchen und ihren Zugangskarten am Gürtel (aber umgedreht! Aus Datenschutzgründen!) mehr und mehr die Stadt vereinnahmen.
Ich finde es schön, dass es noch Menschen gibt, die sich diesem Diktat stur und eigensinnig entziehen. Das ist der Preis der Freiheit.
Gefällt mir Wird geladen …